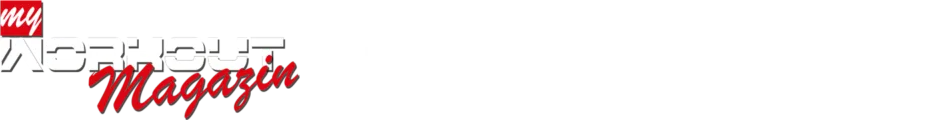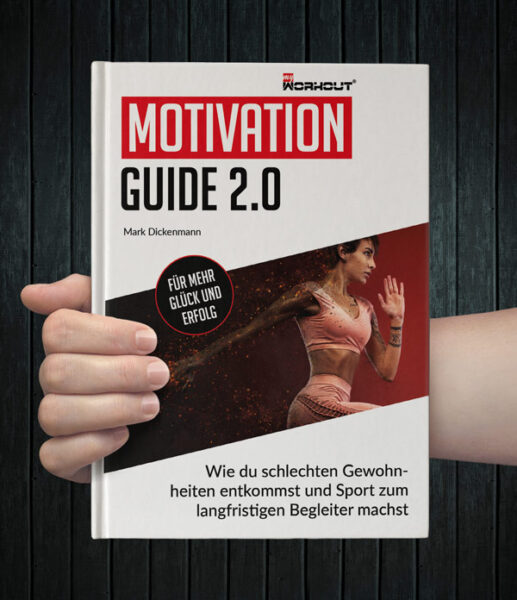Foto: Loaivat, Pixabay
Bei der Neuroathletik steht das gezielte Training des Nervensystems im Mittelpunkt, um die sportliche Leistung zu steigern. Da Bewegung im Gehirn beginnt, hängt unsere Leistungsfähigkeit massgeblich von dessen Fähigkeit zur Koordination und Steuerung ab. Sie geht also weit über Muskelkraft, Ausdauer und Technik hinaus. Was das genau bedeutet, schauen wir uns im folgenden Artikel an.
Inhaltsverzeichnis
- 1.Grundlagen der Neuroathletik
- 2.Unterschied Neuroathletik und neurozentriertes Training
- 3.Die Drei Hauptsäulen der Neuroathletik
- 4.Neuroathletik im Sport
- 5.Was sagt die Wissenschaft?
- 6.Bei welchen Sportarten Neuroathletik am besten wirkt
- 8.Wichtige Grundsätze für das Neuroathletik-Training
- 9.Kritik und Grenzen der Neuroathletik
- 10.Fazit
Grundlagen der Neuroathletik
Die Neuroathletik, auch bekannt als Neurosport, konzentriert sich auf die Optimierung der Informationsverarbeitung im Gehirn. Durch gezieltes Training nervensystembezogener Prozesse, die für die Planung und Steuerung von Bewegungen verantwortlich sind, wird die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen optimiert. Dies führt zu einer verbesserten Kontrolle über den Körper. Da das Ziel die Stärkung des Nervensystems ist, handelt es sich beim Neurosport nicht um klassischen körperlichen Sport, sondern um Gehirnsport, der die Grundlage für jede Bewegung bildet.
Unterschied Neuroathletik und neurozentriertes Training
Bei der Recherche zum Begriff «Neuroathletik» oder «Neurosport» stösst man oft auch auf den des «Neurozentrierten Trainings». Diese beiden Ansätze unterscheiden sich hauptsächlich bezüglich ihrer Zielgruppe:
- Die Neuroathletik zielt darauf ab, die sportliche Performance von Athleten zu verbessern. Vor allem im Profisport wird sie genutzt, um das Nervensystem gezielt zu trainieren und somit Bewegungsabläufe und folglich die körperliche Leistungsfähigkeit zu optimieren.
- Beim neurozentrierten Training hingegen, geht es um die Schmerzlinderung und die Verbesserung der Bewegungsmöglichkeiten innerhalb einer Therapie. Es wird viel in der Rehabilitation eingesetzt, um die Patienten bei der Wiederherstellung von Beweglichkeit und Funktion zu unterstützen. Die Vorgehensweise und die Übungen der Neuroathletik und des neurozentrierten Trainings basieren zwar auf denselben Prinzipien, unterscheiden sie sich allerdings in ihrer Anwendung.
Die Drei Hauptsäulen der Neuroathletik
Das Gehirn erhält seine Informationen aus den folgenden drei Hauptsystemen des Zentralen Nervensystems (ZNS):
- Dem visuellen System (Augen)
- Dem vestibulären System (Gleichgewichtssinn)
- Dem propriozeptiven System, das die Wahrnehmung von Muskeln, Sehnen, Bändern und Knochen umfasst.
Diese Systeme bilden die Grundlage für die Neuroathletik, da sie die Informationsquellen für die Bewegungssteuerung darstellen. Noch bevor eine Bewegung ausgeführt wird, nimmt das Gehirn Informationen aus den verschiedenen Sinnessystemen – visuellen Eindrücken, Gleichgewicht und Körperwahrnehmung – auf, wertet sie aus und interpretiert sie, um koordinierte Bewegungsabläufe effizient und präzise zu steuern.
Um die Sinneseindrücke der Systeme in Bewegungen zu verarbeiten, spielt die motorische Rinde eine zentrale Rolle. Dieser Abschnitt der Grosshirnrinde ist für die Steuerung von Bewegungsabläufen verantwortlich. Über Nervenfasern im Rückenmark sendet sie Signale an die Muskeln, die daraufhin die gewünschte Bewegung ausführen. Die sogenannten Motoneuronen übertragen den Bewegungsimpuls vom Hirnstamm über das Rückenmark bis zu den jeweiligen Muskelzellen.
US-amerikanischen Neurowissenschaftlern zufolge kann der Körper allerdings nur sein volles Leistungspotenzial entfalten, wenn das Gehirn präzise Informationen aus den drei zentralen Steuerungssystemen erhält. Wenn es also Einschränkungen im ZNS gibt, kann dies die körperliche Leistungsfähigkeit erheblich einschränken, da die Informationsverarbeitung gestört wird. Auf Grundlage dieser Steuerungssysteme kann das Nervensystem jedoch gezielt trainiert werden.
Neuroathletik im Sport
Neuroathletik wird im Profisport angewandt, da die Übungen das Zusammenspiel von zentralem und peripherem Nervensystem verbessern. Zum peripheren Nervensystem (PNS) gehören alle Nerven des Körpers, die ausserhalb des Gehirns und Rückenmarks (ZNS) verlaufen. Sie stellen die Verbindung zwischen dem zentralen Nervensystem und den Muskeln sowie Organen her.
Durch das verbesserte Zusammenspiel von ZNS und PNS werden Bewegungen nicht nur effizienter, sondern auch schmerzfreier ausgeführt. Denn eine präzisere Bewegungssteuerung trägt dazu bei, dass das Verletzungsrisiko minimiert wird. Gleichzeitig unterstützt das Training eine verbesserte Körperhaltung und hilft muskuläre Disbalancen auszugleichen.
Ein weiterer Vorteil für Sportler ist das Auflösen unbewusster Schutzmechanismen, die ihre Leistungsfähigkeit unbemerkt einschränken. Durch neuroathletisches Training können diese Blockaden gezielt abgebaut werden, sodass Sportler ihr volles Potenzial ausschöpfen können.
Was sagt die Wissenschaft?
Um den Erfolg der praktischen Anwendung der neuroathletischen Trainingsmethoden anschaulich zu erläutern, betrachten wir zwei relevante Studien:
- Eine Studie von Scharfen und Memmert aus dem Jahr 2021 untersuchte, inwieweit gezieltes kognitives Training durch Gleichgewichts- und Reaktionsübungen das vestibuläre und propriozeptive System von Fussballspielern beeinflusst und ob dies ihre sportliche Leistung verbessert.Hierbei mussten die Sportler beispielsweise auf einem Bein stehen, während sie ihren Kopf nach rechts, links, oben und unten bewegten oder mit schnellen Handbewegungen auf akustische Reize reagieren.Die Studie zeigte Verbesserungen in den trainierten Aufgaben, jedoch gab es nur wenig Transfer auf andere visuelle oder exekutive Funktionen.
- Ähnliches veranschaulicht eine Studie von Maudrich et al. (2022), die untersuchte, ob transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) die motorische Steuerung und sportliche Leistungsfähigkeit verbessern kann. Bei der tDCS handelt es sich um die Anwendung eines schwachen elektrischen Stroms über Elektroden auf der Kopfhaut. Dieser sollte in der Studie gezielt bestimmte Hirnregionen stimulieren oder hemmen, um Prozesse wie motorisches Lernen, Bewegungssteuerung und Reaktionsfähigkeit zu optimieren. Die Teilnehmenden führten kraftorientierte Übungen wie Liegestütze und Kniebeugen durch und bewältigten zudem komplexe motorische Aufgaben, beispielweise Jonglieren. Währenddessen erhielten sie tDCS. Die Ergebnisse zeigten eine Verbesserung der sportlichen Leistung, besonders in Sportarten wie Volley – und Basketball, da hierbei ein Fokus auf der Koordination von visueller Wahrnehmung und zielgerichteter Bewegungsausführung liegt.
Bei welchen Sportarten Neuroathletik am besten wirkt
Neuroathletik kann bei vielen verschiedenen Sportarten hilfreich sein, um die Leistungen von Sportlern zu optimieren. Wie die zuvor erwähnte Studie von Maudrich et al. zeigte, sind die Effekte besonders ausgeprägt in Sportarten, die eine präzise räumliche Wahrnehmung erfordern.
Neuroathletik kann deshalb insbesondere im Team- und Kampfsport wertvolle Vorteile bieten, weil sie Reaktionsgeschwindigkeit und Koordination verbessert. Da neuroathletische Übungen die Feinmotorik fördern, profitieren auch Athleten in dynamischen Spielsituationen davon.
Beim Ausdauersport wie Laufen oder Radfahren werden die Muskeln über einen längeren Zeitraum intensiv beansprucht. Diese Anstrengung kann vom Gehirn als potenziell gefährlich eingeordnet werden, weshalb es den Körper unbewusst einschränkt. Dies führt zu einer schnelleren Ermüdung der Muskeln.
Wenn das Gehirn jedoch auch unter hoher Belastung noch in der Lage ist, Informationen präzise verarbeiten zu können, ermöglicht dies uneingeschränkte und flüssige Bewegungen und die Muskeln halten länger durch. Deshalb kann auch hier neuroathletisches Training hilfreich sein.
Übungen für zu Hause
Um auch deine sportliche Leistung zu verbessern, haben wir im folgenden Abschnitt die effektivsten neuroathletischen Übungen für dich zusammengestellt, die sich problemlos in deinen Alltag integrieren lassen:
Visuelles System
- Finger folgen: Nehme eine aufrechte Haltung ein und strecke den linken Arm auf Schulterhöhe nach vorne. Strecke nun den Zeigefinger hoch und bewege deinen Arm langsam von links nach rechts. Folge deinem Zeigefinger mit den Augen. Kehre zur Mitte zurück und wiederhole die Übung, bewege deinen Arm aber diesmal nach oben und unten.
- Die Acht: suche dir eine freie Stelle im Raum und bestimme mit deinen Augen einen Fixpunkt an der dir gegenüberliegenden Wand. Laufe nun zehn achten auf dem Boden, während dein Blick und dein Oberkörper weiterhin in Richtung des Fixpunktes gerichtet sind.
Vestibuläres System
- Kopfnicken und Schütteln: Bewege deinen Kopf fünfmal auf und ab und anschliessend fünfmal nach links und rechts. Du kannst diese Übung entweder stehend oder sitzend durchführen.
- Kopfnicken und Schütteln beim Gehen: Fixiere einen festen Punkt im Raum mit den Augen. Bewege dann deinen Kopf auf und ab, während du auf den Fixpunkt zu- und wieder zurückgehst. Führe diese Bewegung fünfmal aus. Anschliessend bewegst du den Kopf nach links und rechts, während du weiterhin den Fixpunkt im Blick behältst. Auch diese Übung wiederholst du fünfmal.
- Fokusstabilisation: Halte deinen Blick auf ein festes Objekt wie einen Stift oder deinen Daumen gerichtet. Nicke und schüttle deinen Kopf langsam, während du das Objekt im Blick behältst. Passe die Geschwindigkeit der Kopfbewegungen so an, dass keine Unschärfe entsteht. Ein Metronom oder eine Metronom-App mit 120 bpm kann dir helfen, einen gleichmässigen Rhythmus beizubehalten. Ziel der Übung ist es, die visuelle Stabilität auch bei schnellen Kopfbewegungen zu erhalten.
Propriozeptives System
- Hase und Jäger: Forme mit deiner linken Hand ein Peace-Zeichen, während du mit deiner rechten Hand eine Pistolen-Geste machst und sie auf die andere Hand richtest. Versuche nun die Positionen gleichzeitig zu wechseln.
- Zehen-Zug: Begebe dich in eine Ausfallschrittposition und setze deinen hinteren Fuss so auf, dass die Spannseite deiner Zehen den Boden berührt. Drücke sie leicht in den Boden und spanne dein Bein an, als würdest du den hinteren Fuss über den Boden ziehen, ohne ihn tatsächlich zu bewegen. Konzentriere dich dabei auf die Aktivierung der Mittelfussknochen und Zehen.

Foto: Maurusone
Wichtige Grundsätze für das Neuroathletik-Training
Auch wenn bei der Neuroathletik hauptsächlich das Gehirn beansprucht wird und nicht der Körper, kann dies nichtsdestotrotz zu Erschöpfung führen. Genau wie beim herkömmlichen Training ist es wichtig, Überanstrengung zu vermeiden. Die Signale des Körpers sollten beachtet und das Training beendet werden, wenn Müdigkeit einsetzt.
Wenn das Neuroathletik-Training auf ein konkretes Ziel ausgerichtet ist, empfiehlt es sich zudem, mit einem erfahrenen Trainer zusammenzuarbeiten. Ein Trainer kann dabei unterstützen, die Übungen korrekt auszuführen, Fehler zu vermeiden und eine Überlastung zu verhindern.
Ebenso ist Regeneration von entscheidender Bedeutung, um den Trainingserfolg optimal zu fördern. Das Training sollte grundsätzlich immer individuell auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen jedes Einzelnen abgestimmt werden, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und eine nachhaltige Verbesserung zu gewährleisten.
Kritik und Grenzen der Neuroathletik
Die wissenschaftliche Beweislage zur Effektivität des neuroathletischen Trainingsansatzes ist derzeit noch begrenzt, weshalb es bisher keine eindeutige wissenschaftliche Evidenz für die Wirkung gibt. Somit könnte auch der Placebo-Effekt eine Rolle spielen. Die Wirksamkeit der Übungen wäre dann vielmehr an den Glauben an die Wirksamkeit der Übungen zurückzuführen und nicht auf die Übungen selbst. Um den Placebo-Effekt definitiv ausschliessen zu können, müssten also noch weitere Studien durchgeführt werden.
Fazit
Zusammenfassend stärkt Neuroathletik also das Nervensystem durch gezieltes Training, wodurch das Zusammenspiel der drei Hauptsinnessysteme – visuelles, vestibuläres und propriozeptives System – des Zentralen Nervensystems verbessert wird. Bewegungen können so präziser und effektiver ausgeführt und somit das allgemeine Verletzungsrisiko reduziert werden. Obwohl die wissenschaftliche Beweislage noch begrenzt ist, zeigen erste Studien vielversprechende Ergebnisse. Insbesondere in Sportarten, die hohe Anforderungen an Koordination und Reaktionsgeschwindigkeit stellen.
Quellen:
- https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/sport/bewegung-und-fitness/neuroathletik-1299580
- https://www.aok.de/pk/magazin/sport/workout/was-ist-neuroathletik-training/
- https://de.beatyesterday.org/active/neuroathletik-6-effektive-uebungen-fuer-gehirn/
- https://www.zdf.de/nachrichten/wissen/neuroathletik-neurozentriertes-training-olympia-100.html
- https://www.brainbasedmovement.de/post/neuroathletik-was-ist-das
- https://www.st-augustinus-kliniken.de/therapeutisches-training/neuroathletik
- https://mein.sanofi.de/themen/bewegung/bewegung-und-gehirn#:~:text=Die%20motorische%20Rinde%2C%20ein%20Teil,den%20Bewegungsreiz%20an%20die%20Muskelzellen
- https://fitminex.de/blogs/fitminex-blog/5-neuroathletik-uebungen?srsltid=AfmBOoqFh6-1rmTw0_i_AiIEYKnIx-BiLjgUaDUVlcHh-djMm4o50_Qi
- https://link.springer.com/article/10.1007/s12662-020-00699-y
- https://www.brainstimjrnl.com/article/S1935-861X(22)00243-1/fulltext
- https://www.neurocaregroup.com/de/tdcs-transcranielle-gleichstromstimulation
- https://studyflix.de/biologie/peripheres-nervensystem-2690